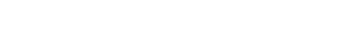Liebe Leser:innen,
dieser Blogbeitrag widmet sich dem Thema: Befund versus Befinden. Angeregt durch den Beitrag von Prof. Volker Busch- Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Regensburg- in der Zeitschrift Gehirn und Geist von 8/25.
Wie Herr Prof. Busch völlig zurecht schreibt, mögen Befund und Befinden zwei verschiedene Wahrheiten sein, aber sie haben etwas sehr wichtiges gemeinsam: sie sind beide echt! Und genau diese Aussage spiegelt meine Praxisphilosophie absolut wieder!
Denn jedes Symptom ist ein Lösungsversuch des Körpers, der verstanden, anerkannt und ernstgenommen werden will.
Birgit Schroeder, Heilpraktikerin, Praxis für individuelle Diagnostik und Therapie in Köln
Auch wenn sich die Beschwerden des Patienten/ der Patientin in der sehr technisch orientierten Medizin nicht darstellen und damit beweisen lassen, sind sie aber dennoch echt. Mit dieser Grundhaltung den Patient:innen in der tagtäglichen Praxis zu begegnen ist für mich unabdingbar, denn nur so können Patient:in und Therapeut:in ein hochwertiges, therapeutisches Bündnis eingehen. Und dieses Bündnis wird getragen durch Wertschätzung, Empathie und Verständnis für Ihre Lebenssituation und Ihre Symptome.

Befund
versus
Befinden
Befund versus Befinden- und die Suche nach bio-psychosozialen Ursachen
Geprägt durch meine Weiterbildung in der klinischen Psycho- Neurologe- Immunologie erfolgt eine Diagnosenstellung u.a. durch folgende Aspekte:
- der Suche nach biologischen Ursachen: hier geht es um Labortechnische Untersuchungen, deren Interpretation Hinweise bezüglich der Symptome geben können (faktische Basis)
- der Suche nach psycho-sozialen Faktoren: hier können belastende Lebensumstände eine Rolle spielen, aber auch negative Emotionen (Angst/ Ohnmacht/ Trauer etc.)
Lesen Sie diesbezüglich gerne auch mehr unter Gesundheitscoaching.
In der Psycho-Neuro-Immunologie erfolgt genau nicht! die Trennung von Körper und Geist, sondern es werden Verknüpfungen zwischen einzelnen Organsystem hergestellt, wodurch der Patient/ die Patientin im Ganzen gesehen wird und Zusammenhänge erkannt werden.
Historische Trennung von Körper und Geist: eine differenziertere Sichtweise ist nötig
Die historische Trennung von Körper und Geist wurde geprägt durch den französischen Philosophen Descartes. Diese Trennung läßt sich durch einen prägnanten Satz auf den Patientenalltag reduzieren: Entweder sind die Beschwerden physisch oder psychisch.
Dr. Volker Busch beschreibt in seinem Artikel in der Zeitschrift Gehirn und Geist ein Untersuchungsergebnis seiner eigenen Arbeitsgruppe:
“Personen mit Schmerzerkrankungen berichteten nach Schlafentzug von stärkeren Beschwerden, obwohl ihre experimentell gemessenen Schmerzschwellen unverändert blieben.”
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an Prof. Volker Busch, denn wie er schreibt öffnete die Epoche der Aufklärung die Tür für die evidenzbasierten Medizin, hinterließ aber auch ein falsches Bild von Körper und Geist.
Zum Wohle des Patienten/ der Patientin gilt es diese dualistische Einteilung aufzubrechen.
Links zu Professor Volker Busch: