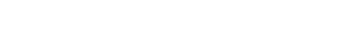Liebe Leser*innen,
werden unsere Darmbakterien durch die Bauchspeicheldrüse kontrolliert? Dieser Frage ist eine Arbeitsgruppe der Unimedizin Greifswald nachgegangen um Herrn Prof. Lerch und Kollegen. Die technische Entwicklung bei Untersuchungen des Erbmaterials von Bakterien hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Im Bereich der Darmbakterien wurden diese lange Zeit auf Nährböden (Petrischalen) angezüchtet. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass sich mehr als 95 Prozent der Darmbakterien überhaupt nicht vermehren, wenn sie der Luft ausgesetzt sind, sondern eben nur im Darm wachsen. Inzwischen können aber dank der rasanten Entwicklung molekulargenetische (sog. Microbiom-) Untersuchungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass inzwischen viele im Darm lebende Mikroorganismen identifiziert werden können.
Alte Feunde versus neue Feinde
Der menschliche Körper besteht nicht nur aus Milliarden spezialisierter Zellen, in ihm leben auch zahllose Mikroorganismen mit uns zusammen, in der Regel friedlich und nutzbringend. Sie werden auch als sog. alte Freunde bezeichnet.
Allein im Darm finden sich etwa 38 Billionen Bakterien (3,8 x 1013), somit deutlich mehr als alle unsere Körperzellen zusammen. Weil Bakterien sehr viel kleiner sind als menschliche Körperzellen, kommen diese Bakterien zusammen auf ein Gewicht von nur 2 Kg (Beckmann und Rüffler, Bad Booklet, 2012). Die gesunde Darmflora ist maßgebend, ob wir gesund bleiben oder krank werden.
Gesunde Darmflora: die Vielfalt im Darm ist gesundheitsfördernd
So wissen wir heute, dass im Darm fast 40.000 verschiedene Bakterienarten zu Hause sind. Wie diese sich in ihrer Art und Menge zusammensetzen, hat großen Einfluss auf unsere allgemeine Gesundheit. Ein besonders artenreiches Darmmikrobiom, so nennt man die Gesamtheit der Mikroorganismen, hat gesundheitsfördernde Wirkungen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Diversität des Microbioms. Viele Erkrankungen gehen mit einer Abnahme der Artenvielfalt der Bakterien im Darm einher. Diskutiert werden Zusammenhänge zwischen dem Microbiom und Diabetes mellitus, der Fettlebererkrankung bis hin zur Depression, um nur einige Beispiele zu nennen.
Was aber bestimmt die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm?
Zum einen ist die Mischung der Bakterienarten des Menschen erblich bedingt und kann fast als persönlicher Fingerabdruck angesehen werden. Zum anderen sind bekannte Einflussfaktoren für die Zusammensetzung des Mikrobioms die Präferenz des Essens, etwa tierische Proteine oder vegane Kost, aber auch das Rauchen oder eine „Western style diet“ nehmen Einfluß (siehe Blogbeitrag vom 14.09.2018).
Studie der Unimedizin Greifswald
Eine Arbeitsgruppe an der Unimedizin Greifswald hat bei 1.800 SHIP-Probanden (Study of Health in Pomerania) entdeckt, dass die Zusammensetzung der Darmbakterien viel stärker von der Funktion der Bauchspeicheldrüse kontrolliert wird als von allen anderen bekannten Faktoren. Was uns sehr überrascht hat ist die Stärke des Effekts“, betonte der Direktor der Inneren Klinik A an der Unimedizin Greifswald, Prof. Markus M. Lerch.

Foto Natalimis (123rf.com)
„Die Bauchspeicheldrüse kontrolliert die Artenvielfalt der Bakterien im Darm viel tiefgreifender als alle bisher bekannten Wirtsfaktoren wie Alter, Geschlecht, die Art der Ernährung oder zum Beispiel die Einnahme von Magensäureblockern.“
Hören und lesen Sie hierzu auch gerne den kPNI- Podcast Nr. 63 oder den Blog zu dem Thema „Dünndarmfehlbesiedlung“
Zusammenhang zwischen Darmbakterien und Verdauung verstehen
Eine auf Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) spezialisierte Arbeitsgruppe der Universitätsmedizin Greifswald um die Klinik für Innere Medizin A und die Abteilung für Funktionelle Genomforschung hatte untersucht, ob und wie dieses Organ das Mikrobiom beeinflusst.
Hierzu wurden bei 1.800 Probanden der Greifswalder Gesundheitsstudie SHIP die Zusammensetzung des Stuhlmikrobioms mittels Sequenzierung der bakteriellen Erbinformation (16S rRNA) analysiert. Neben vielen anderen Faktoren haben die Wissenschaftler sowohl die Konzentration von Elastase, einem Verdauungsenzym der Bauchspeicheldrüse, im Stuhl gemessen, als auch die stimulierte Ausscheidung von Pankreassaft in den Dünndarm mittels Kernspintomographie.
Eine verminderte Konzentration der Elastase war mit starken Veränderungen der Zusammensetzung und Artenvielfalt des Mikrobioms verknüpft. Beispielsweise fanden sich ein Anstieg der eher gesundheitsschädlichen Prevotella-Bakterien und eine Abnahme der gesundheitsförderlichen Bacteroides-Arten. Der Einfluss des Volumens des Pankreassaftes auf die Vielfalt der Bakterienstämme war dabei deutlich geringer als die Konzentration des Verdauungsenzyms Elastase.
So schreibt das Medizinisches Versorgungszentrum an der Universitätsmedizin Greifswald GmbH.
kPNI: Microbiomdiagnostik und Maldigestion
Eine verminderte Funktionsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse kann mannigfaltige Ursachen haben. Ernährungsfehler, Stress oder aber eine Insulinresisenz können hier Einfluß nehmen.
Zu einer guten und umfangreichen Diagnostik des Microbioms gehören demzufolge ergänzende Parameter der Maldigestion wie Verdauungsrückstände, Pankreaselastase oder Gallensäuren etc.

Foto Nelson Marques (123rf.com)
Hören Sie hierzu auch gerne den kPNI- Podcast Nr.60.
Wenden Sie sich bei Fragen zur Microbiomdiagnostik auch gerne direkt an die Praxis am Sachsenring in Köln, Ihre Praxis für Ernährungsberatung, kPNI und Gesundheitscoaching.
Ihre Heilpraktiker- Praxis, Praxis für KPNI
Birgit Schroeder, Master in kPNI